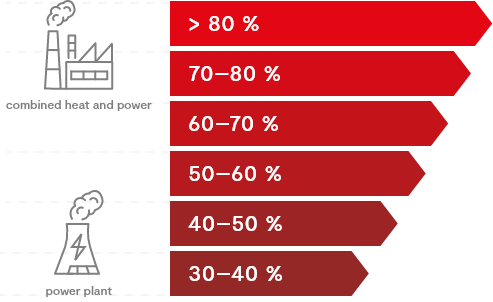Die EU setzt ihre Verpflichtung zur Reduzierung von Emissionen bis 2030 durch das "Fit für 55"-Paket um, das im Juli 2021 im Rahmen des europäischen Klimagesetzes verabschiedet wurde. Das größte Paket in der Geschichte der Kommission beinhaltet eine umfassende Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften, um die Klimaziele zu erreichen und bis 2050 klimaneutral zu werden. Zentral ist die Reform des EU-Emissionshandelssystems (EU-EHS), das seit 2005 zu einer 41%igen Emissionsreduktion geführt hat.
Im März 2023 haben sich die Umweltminister:innen der EU auf eine überarbeitete Lastenteilungsverordnung geeinigt, die das EU-weite Ziel für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 in nicht-EHS-Sektoren von 29 % auf 40 % gegenüber 2005 erhöht. Gleichzeitig wurde eine allgemeine Ausrichtung des Rates zur Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor erreicht.
Auch in Bezug auf das Paket für den Wasserstoffmarkt und den dekarbonisierten Gasmarkt hat der Rat seine Standpunkte festgelegt. Ziel des Pakets ist der Übergang von Erdgas zu erneuerbaren und CO₂-armen Gasen sowie die Förderung ihrer Akzeptanz in der EU bis 2030 und darüber hinaus.
Im Dezember 2023 erzielten der Rat und das Parlament eine vorläufige politische Einigung über eine Verordnung, die gemeinsame Vorschriften für erneuerbare Gase, Erdgas und Wasserstoff festlegt.